3. Fortbildungsseminar Palliative Care
Herausforderungen in der letzten Lebensphase – medizinische Notfälle und psychoexistenzielle Leiden am Lebensende
Am 27. März 2025 wird unter der fachlichen Leitung von Dr. med. Raoul Pinter das dritte Fortbildungsseminar Palliative Care des Palliativ-Netzes Liechtenstein in Kooperation mit der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland und der UFL stattfinden.
Diese Veranstaltung richtet sich an Experten und Fachleute, sowie alle, die in der Palliative Care tätig sind. Ziel der Veranstaltung ist es, sich über aktuelle Entwicklungen in der Palliative Care zu informieren und sich weiter zu bilden. Die Bedeutung der disziplinären Vielfalt, der ganzheitlichen Ansätze, der interdisziplinären Zusammenarbeit und der regionalen Verankerung im Bereich von Palliative Care werden an Beispielen in Fachvorträge und Workshops veranschaulicht.
Facts
Datum | Donnerstag, 27. März 2025, 8.00–17.30 Uhr |
Ort | Gemeindesaal Triesen UFL, Spoerry Triesen |
Credits | Liechtensteinische Ärztekammer: 7 Credits (4 Credits Vormittag (inkl. Workshop), 3 Credits Nachmittag) palliative.ch: 7 Credits SGAIM: 6 Kernfortbildungscredits AIM |
Kosten | CHF 350.00 Teilnahmegebühr (inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung) CHF 200.00 Teilnahmegebühr halbtags |
Leitung

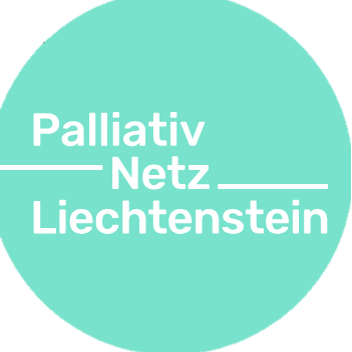
Forellenweg 10
FL-9490 Vaduz
Programm
- Dr. med. Daniel Büche | Chefarzt Innere Medizin FMH, Psychosomatische Medizin SAPPM, Schmerzspezialist | Rehazentrum St.Gallen
- Dr. med. Cristian Camartin | Leitender Arzt Palliative Care | Kantonsspital Graubünden
- Angela Jussel | Assistenzärztin Palliative Care | H-OCH-Spitäler
- Azra Karabegovic | Institut für Pflege, Departement Gesundheit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), MScN und Doktorandin an der UFL
- Patricia Mojzisek | Pflegeexpertin, MAS Palliative Care | Thurvita AG
- Dr. med. Maximilian Mölleney | Oberarzt Palliative Care | Spital Altstätten
- Dr. med. Raoul Pinter | Ärztlicher Leiter Palliative Care | H-OCH-Spitäler Altstätten und Grabs
- Michael Rogner | Leiter Pflegeentwicklung, Msc. Mag. | Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)
- Dr. med. Markus Schettle | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Palliative Care an der UZH/USZ und Chirurg/Hausarzt bei PizolCare Sargans
- Elisabeth Sommerauer | Pflegeexpertin, MAS Palliative Care | Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)
- Prof. Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel | Leiter Klinische Ethik | Universitätsspital Bale (USB) und Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK)
- Stefanie Zimmermann | DGKP, MSc Palliative Care | Palliativstation LKH Hohenems
Notfallsituationen am Lebensende unterscheiden sich von den üblichen Notfällen im medizinischen Alltag. Im Vortrag und Workshop werden diverse Notfallsituationen besprochen und das entsprechende Vorgehen beleuchtet.
Die palliative Sedation zielt darauf ab, das Leiden von Patienten:innen in der letzen Lebensphase zu lindern, wobei dieses Leiden sowohl körperliche, seelische als auch soziale Dimensionen umfassen kann. In meinem Vortrag werde ich, basierend auf den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Perspektiven der Patienten:innen, der Angehörigen und des Behandlungsteams einbeziehen und erläutern, wie diese Therapie in der Praxis angewendet wird, um körperliche, emotionale und soziale Belastungen zu verringern und dabei ethische Richtlinien zu berücksichtigen.
Das Prinzip der Hoffnung kann aus einem theologischen, philosophischen, soziolgischen oder pflegerischen Ansatz betrachtet werden. Im Vortrag möchte ein Bewusstsein für die Breite dieses Themas geschaffen und gleichzeitig mögliche Ansätze für eine pragmatische Vorgehensweise im Alltag der Palliative Care aufgezeigt werden. Wichtig erscheint dabei, dass wir ein interprofessionelles Verständnis für diesen Begriff bekommen und verstehen, dass es beim Begriff der Hoffnung interprofessionelle Verständnisschwierigkeiten geben kann. Im Workshop werden diese Themen vertieft und eigene Erfahrungen eingeordnet.
Sterben ist ein existenzieller Teil des Lebens, dessen komplexe Abläufe in der Palliativmedizin noch unzureichend verstanden sind. Häufig finden sich Berichte über Grenzerfahrungen wie Nahtoderlebnisse, Sterbebettvisionen und Nachtodkontakte, die wichtige Ressourcen für Patienten und Angehörige darstellen. Diese Phänomene werden oft stigmatisiert und als selten wahrgenommen, obwohl aktuelle Studien darauf hindeuten, dass sie eher normal sind und von betroffenen Menschen in ihrer Wachphase klar beschrieben werden können.Eine intensivere Auseinandersetzung mit visionärem Erleben in der Nähe des Todes ist notwendig, um das Verständnis zu fördern, diese Erfahrungen zu erkennen und eine bessere Sterbebegleitung zu ermöglichen. Es ist essenziell, die damit verbundenen Themen zu enttabuisieren und zu lernen, diese Erlebnisse von belastenden Situationen wie Unruhe und Delir zu unterscheiden. Dadurch können Palliativteams eine qualitativ hochwertige End-of-Life-Care gewährleisten und betroffene Menschen sowie ihre Begleiter angemessen unterstützen.
Am Lebensende bestehen verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die unterschiedliche rechtliche und ethische Fragen aufwerfen. Beim Freiwilligen Verzicht auf Ernährung und Flüssigkeit (FVNF) stellen sich besondere Herausforderungen: Handelt es sich um einen Suizid oder um eine separate Form der Beendigung des eigenen Lebens?
Wann gestehen wir einer Person zu, dass sie einen FVNF freiverantwortlich beginnt? Was ist, wenn eine Person während eines FVNF ein Delir entwickelt und nicht mehr urteilsfähig ist? Welche Formen der Unterstützung beim FNVF durch Fachpersonen sind moralisch angemessen? Darf eine Person zur
Unterstützung bei belastenden Symptomen im Rahmen von FVNF (z.B. unerträglicher Durst) sediert werden? Diese und weitere ethische Fragen zu FVNF werden thematisiert.»
Referent : Dr. med. Cristian Camartin | Leitender Arzt Palliative Care Kantonsspital Graubünden
Inhalt
Notfallsituationen am Lebensende unterscheiden sich von den üblichen Notfällen im medizinischen Alltag. Im Vortrag und Workshop werden diverse Notfallsituationen besprochen und das entsprechende Vorgehen beleuchtet.
Referent: Dr. med. Maximilian Mölleney | Oberarzt Palliative Care Spital Altstätten
Inhalt
Sterben ist ein existenzieller Teil des Lebens, dessen komplexe Abläufe in der Palliativmedizin noch unzureichend verstanden sind. Häufig finden sich Berichte über Grenzerfahrungen wie Nahtoderlebnisse, Sterbebettvisionen und Nachtodkontakte, die wichtige Ressourcen für Patienten und Angehörige darstellen. Diese Phänomene werden oft stigmatisiert und als selten wahrgenommen, obwohl aktuelle Studien darauf hindeuten, dass sie eher normal sind und von betroffenen Menschen in ihrer Wachphase klar beschrieben werden können.Eine intensivere Auseinandersetzung mit visionärem Erleben in der Nähe des Todes ist notwendig, um das Verständnis zu fördern, diese Erfahrungen zu erkennen und eine bessere Sterbebegleitung zu ermöglichen. Es ist essenziell, die damit verbundenen Themen zu enttabuisieren und zu lernen, diese Erlebnisse von belastenden Situationen wie Unruhe und Delir zu unterscheiden. Dadurch können Palliativteams eine qualitativ hochwertige End-of-Life-Care gewährleisten und betroffene Menschen sowie ihre Begleiter angemessen unterstützen.
Referierende:
Dr. med. Raoul Pinter | Ärztlicher Leiter Palliative Care H-OCH-Spitäler Altstätten und Grabs
Michael Rogner, Mag. Msc. | Leiter Pflegeentwicklung Lie. Alters- und Krankenhilfe (LAK)
Inhalt
Dieser Workshop widmet sich herausfordernden Situationen in der Palliative Care, mit einem ersten Schwerpunkt auf dem Symptommanagement. Ziel ist es, gemeinsam Erfahrungen zu reflektieren, Kompetenzen zu erweitern und die interprofessionelle Zusammenarbeit zu stärken. Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Therapie und Sozialarbeit schaffen in den Fallbesprechungen einen Raum für Austausch und persönliche Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt stehen die konkreten Fälle der Teilnehmenden, die gemeinsam bearbeitet und praxisnah diskutiert werden.
Angeleitet durch die SENS-Strukturhilfe und unterstützt von kurzen fachlichen Impulsen, werden Lösungen erarbeitet, die sich direkt in den Berufsalltag integrieren lassen. Organisiert vom Palliativ-Netz Liechtenstein, finden ab 2025 die Fallbesprechungen quartalsweise an der Privaten Universität Liechtenstein (UFL) statt. Der Kick-off erfolgt direkt im Rahmen der Tagung.
Referierende
Angela Jussel | Assistenzärztin Palliative Care H-OCH-Spitäler
Elisabeth Sommerauer | Pflegeentwicklung/Fachexpertin Palliative Care, CAS Palliative Care Lie. Alters- und Krankenhilfe (LAK)
Inhalt
Immer wieder begegnen uns bei der täglichen Arbeit in der Palliative Care Aussagen wie «Ich bin doch nur eine Last für andere und zu nichts mehr nutze», «War ich denn so ein schlechter Mensch, dass ich so sehr leiden muss? » oder «Was bleibt denn von mir, wenn ich sterbe? ». Viel mehr noch ist es das unausgesprochene Leid, das oft als Schwere, große Traurigkeit oder auch Weh im Gespräch mit den Betroffenen spürbar ist, das uns beschäftigt. Es ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung den Patienten zu helfen, Worte für das zu finden, was sie so sehr belastet, Lösungen zu finden, oder einfach da zu sein und gemeinsam auszuhalten. Anhand von Fallbeispielen werden wir gemeinsam erarbeiten, wo die Herausforderungen sind und welche Vorgehensweisen und Unterstützungsmöglichkeiten uns in diesen Situationen helfen können.
Referentin: Stefanie Zimmermann DGKP, MSc Palliative Care | Palliativstation LKH Hohenems
Inhalt
Der Workshop «Resilienz» beschäftigt sich mit den Arbeitsumständen und Herausforderungen, die sich in der Palliative Care manifestiert haben. Die ständige Konfrontation mit Sterben und Tod ist nicht die einzige Herausforderung, der sich das Betreuungsteam stellen muss, sondern auch organisationale Aspekte wie Zeitmangel, zunehmende Arbeitsbelastung durch Belegungsdruck, vermehrte Patientenfluktuation durch kürzere stationäre Aufenthalte. Was benötigt es für einen stimmigen Umgang mit Therapiezieländerungen oder im Umgang mit Therapierückzug? Was tun, wenn die Meinungen zu den genannten Themen im behandelnden Team auseinandergehen? Es stellt sich die Frage, wie das Betreuungspersonal unter den herausfordernden Bedingungen weiterhin eine bereichernde Palliativarbeit leisten kann, ohne dass dabei die ursprüngliche Essenz der Hospiz- und Palliativbewegung verloren geht. Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit, als grundlegende und erlernbare Kompetenz, soll im Workshop im Fokus stehen. Es werden Fähigkeiten durch Reflexion des eigenen Berufsalltags erarbeitet, welche die berufliche und eigene Resilienz fördern und damit die Belastungen reduziert werden können. Auch wird Augenmerk auf Bereicherungen im Berufsalltag gelegt, welche einen starken Einfluss auf die Berufszufriedenheit und das Wohlbefindenden von Betreuungsteams im palliativen Setting haben.
Referent: Dr. med. Daniel Büche | Chefarzt Innere Medizin FMH, Psychosomatische Medizin SAPPM, Schmerzspezialist Rehazentrum St.Gallen
Inhalt
Das Prinzip der Hoffnung kann aus einem theologischen, philosophischen, soziolgischen oder pflegerischen Ansatz betrachtet werden. Im Vortrag möchte ein Bewusstsein für die Breite dieses Themas geschaffen und gleichzeitig mögliche Ansätze für eine pragmatische Vorgehensweise im Alltag der Palliative Care aufgezeigt werden. Wichtig erscheint dabei, dass wir ein interprofessionelles Verständnis für diesen Begriff bekommen und verstehen, dass es beim Begriff der Hoffnung interprofessionelle Verständnisschwierigkeiten geben kann. Im Workshop werden diese Themen vertieft und eigene Erfahrungen eingeordnet.
Referierende
Azra Karabegovic, MScN, RN | Pflegeexpertin APN – Co-CEO bei Carela und Doktorandin an der UFL
Patricia Mojzisek | Pflegeexpertin MAS Palliative Care Thurvita Wil
Inhalt
Dieser Workshop beleuchtet die besonderen Herausforderungen in der ambulanten Palliativversorgung von Menschen mit psychischen Symptomen in der End-of-Life-Phase. Ziel ist es, Fachkräfte für die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe zu sensibilisieren und interdisziplinäre Ansätze zur Verbesserung der Versorgungsqualität zu entwickeln. In einem World-Café wird das Wissen der Workshop Teilnehmenden und deren Perspektiven gesammelt. Daraus werden interdisziplinäre praxisnahe Strategien erarbeitet, um die psychische Gesundheit und die Lebensqualität der Betroffenen am Lebensende zu fördern.
Referent: Prof. Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel | Leiter Klinische Ethik USB Universitätsspital Basel
Inhalt
Am Lebensende bestehen verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die unterschiedliche rechtliche und ethische Fragen aufwerfen. Beim Freiwilligen Verzicht auf Ernährung und Flüssigkeit (FVNF) stellen sich besondere Herausforderungen: Handelt es sich um einen Suizid oder um eine separate Form der Beendigung des eigenen Lebens?
Wann gestehen wir einer Person zu, dass sie einen FVNF freiverantwortlich beginnt? Was ist, wenn eine Person während eines FVNF ein Delir entwickelt und nicht mehr urteilsfähig ist? Welche Formen der Unterstützung beim FNVF durch Fachpersonen sind moralisch angemessen? Darf eine Person zur
Unterstützung bei belastenden Symptomen im Rahmen von FVNF (z.B. unerträglicher Durst) sediert werden? Diese und weitere ethische Fragen zu FVNF werden thematisiert.
Experten und Fachleute, Interessierte und alle in der Palliative Care Tätigen
Teilnahmebescheinigung.
Liechtensteinische Ärztekammer: 7 Credits (4 Credits Vormittag (inkl. Workshop), 3 Credits Nachmittag) palliative.ch: 7 Credits SGAIM: 6 Kernfortbildungscredits AIM |
Ansprechperson

Eine Kooperationsveranstaltung des Palliativ-Netzes Liechtenstein zusammen mit:





